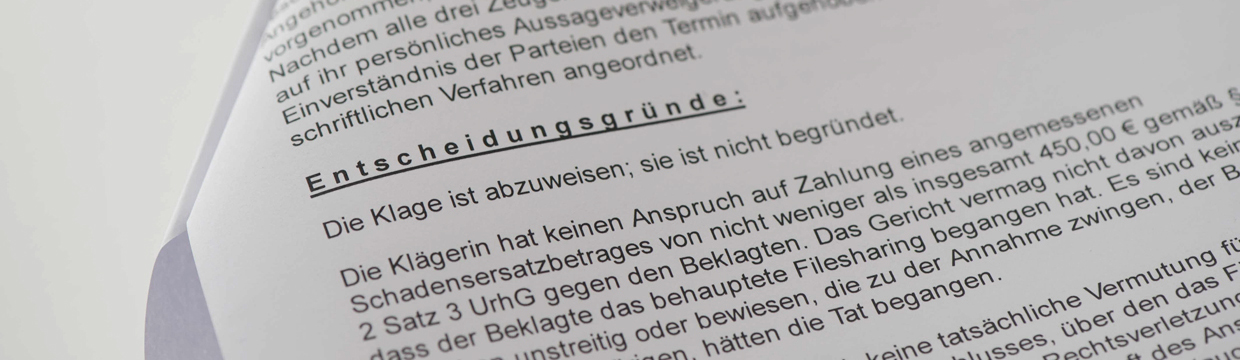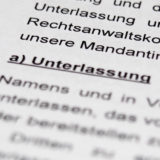Urteil des BGH vom 03.03.2016, Az.: I ZR 110/15
a) Die Prüfung, ob die Geltendmachung von Ansprüchen wegen Rechtsmissbrauchs nach § 8 Abs. 4 UWG unzulässig ist, hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände zu erfolgen. In diese Beurteilung sind nach der vorgerichtlichen Abmahnung auftretende Umstände auch dann einzubeziehen, wenn ein rechtsmissbräuchliches Verhalten im Zeitpunkt der Abmahnung nicht festzustellen ist.
b) Die durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGBl. I 2015, S. 2158) in § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG eingefügte Relevanzklausel trägt dem Wortlaut des Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken Rechnung und beinhaltet gegenüber der bisherigen Rechtslage im Hinblick darauf, dass schon bisher im Rahmen des § 3 Abs. 1 UWG aF die Spürbarkeit der Interessenbeeinträchtigung zu prüfen war, keine inhaltliche Änderung.
c) Die irreführende Werbung mit einer nicht mehr bestehenden Herstellerpreisempfehlung ist regelmäßig geeignet, den Verbraucher im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er ansonsten nicht getroffen hätte. Die Preisempfehlung stellt für den Verbraucher eine wesentliche Orientierungshilfe bei der Einschätzung der Vorteilhaftigkeit von Marktangeboten dar.
d) Ein Händler, der auf einer Internet-Handelsplattform in seinem Namen ein Verkaufsangebot veröffentlichen lässt, obwohl er dessen inhaltliche Gestaltung nicht vollständig beherrscht, weil dem Plattformbetreiber die Angabe und Änderung der unverbindlichen Preisempfehlung vorbehalten ist, haftet als Täter für den infolge unzutreffender Angabe der Preisempfehlung irreführenden Inhalt seines Angebots.