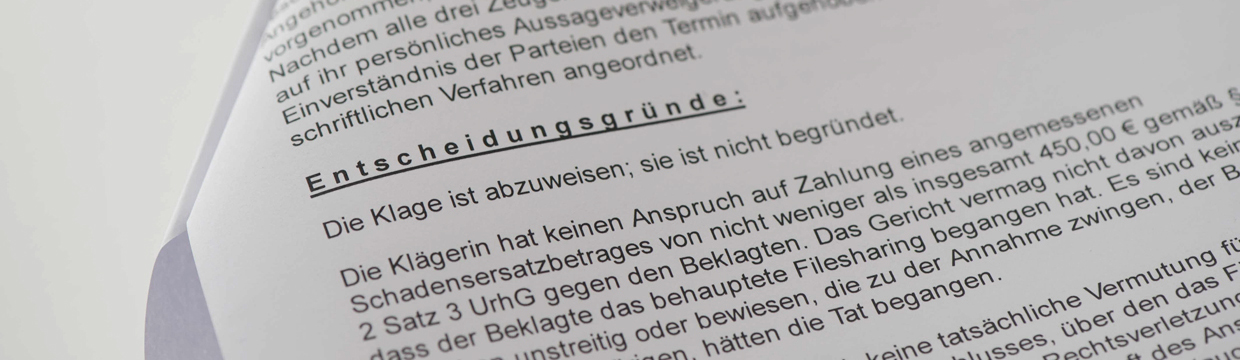Keine Erstbegehungsgefahr bei Produktpräsentation auf Fachmesse

a) Eine Erstbegehungsgefahr des Bewerbens, Anbietens, Vertreibens und Inverkehrbringens gegenüber inländischen Verbrauchern folgt nicht ohne weiteres aus der Präsentation des Produkts (hier: Keksstangen) auf einer internationalen, ausschließlich dem Fachpublikum zugänglichen Messe.
b) Die bei einem Fachpublikum vorhandenen Kenntnisse der am Markt vertretenen Produkte, ihrer Gestaltung und ihrer Herkunft stehen auch im Hinblick auf nahezu identische Nachahmungsprodukte regelmäßig der Annahme einer unmittelbaren Verwechslung mit dem Originalprodukt und der irrtümlichen Annahme von geschäftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen entgegen, wenn die Produkte in Packungen mit gegenüber dem Originalprodukt deutlich unterschiedlichen Herkunftshinweisen vertrieben werden.